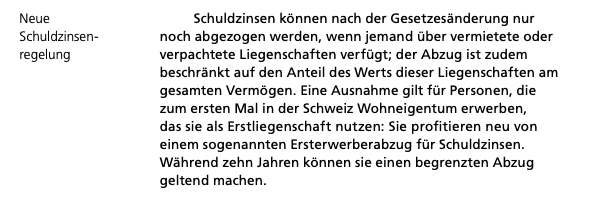Hypothekarzinsen in der Schweiz
Du denkst über einen Hauskauf oder die Verlängerung deiner Hypothek nach? Dann kommst du um ein Thema nicht herum: Hypothekarzinsen. Klingt trocken, ist aber entscheidend für dein Budget – und für schlaflose Nächte (oder eben nicht). Hier erfährst du einfach und verständlich, was es mit Hypothekarzinsen auf sich hat, wie du Hypotheken (Fest vs. Variabel, SARON-Zinssatz & Co.) vergleichst, welche Fehler du vermeiden solltest und warum eine unabhängige Finanzberatung dabei Gold wert ist. Los geht’s!
Was sind Hypothekarzinsen?
Hypothekarzinsen sind schlicht der Preis fürs Geldleihen bei einer Immobilienfinanzierung. Wenn du bei der Bank oder Versicherung (z. B. Baloise) eine Hypothek aufnimmst, zahlst du dafür Zinsen – so verdient der Anbieter sein Geld. Diese Zinsen sind die Kosten, die du dem Kreditgeber für das geliehene Kapital entrichtest. Wichtig: In diesen Zinskosten sind nur die reinen Schuldzinsen enthalten, nicht die Rückzahlung (Amortisation) deiner Hypothek, und auch nicht Unterhalts- oder Nebenkosten für die Immobilie.
Wie setzen sich Hypothekarzinsen zusammen?
Die Höhe deines Hypothekarzinses hängt von mehreren Faktoren ab. Zum einen beeinflusst das generelle Zinsumfeld (Stichwort Leitzins der Schweizerischen Nationalbank) das Niveau. Zum anderen legen Banken einen Basiszinssatz zugrunde und schlagen darauf ihre Marge auf. Bei variabel verzinsten Hypotheken orientiert sich der Basiszins oft am Geldmarktsatz SARON (dazu gleich mehr). Auf diesen Basiszins addiert die Bank eine feste Marge, die von deiner Kreditwürdigkeit und dem Belehnungswert abhängt. Typischerweise liegt die Marge in der Schweiz irgendwo zwischen ca. 0,8% und 1,3%. Kunden mit guter Bonität und viel Eigenkapital bekommen meist die tiefsten Aufschläge.
Auch die Laufzeit deiner Hypothek spielt eine Rolle: Für langfristige Festhypotheken verlangen Anbieter meist einen höheren Zins als für kurzfristige Gelder. Der Grund: Lange Zinsbindung bedeutet für die Bank ein grösseres Risiko (wer weiss schon, wo die Zinsen in 10 Jahren stehen?). Deshalb sind Zinssätze für kurze Laufzeiten im Normalfall tiefer als jene für lange Laufzeiten. Zusammengefasst setzt sich dein Hypothekarzins also grob aus dem aktuellen Marktzinssatz plus der Bankmarge zusammen. Ob dieser Satz fix bleibt, oder sich laufend ändert, hängt vom Hypothekarmodell ab – und genau das schauen wir uns als Nächstes an.
Festhypothek oder variable Hypothek (SARON)?
Bei der Hypothek hast du in der Regel die Qual der Wahl zwischen einer Festhypothek und einer variabel verzinsten Hypothek. Was ist der Unterschied?
- Festhypothek: Hier wird der Zinssatz für eine bestimmte Dauer festgeschrieben – üblich sind z. B. 5, 10 oder sogar 15 Jahre. Während dieser Zeit bleibt dein Hypothekarzins unverändert, egal was der Markt macht. Vorteil: Du hast Planungssicherheit und weisst, mit welchen Zinskosten du rechnen musst. Selbst wenn die Zinsen am Markt steigen, betrifft dich das nicht (du kannst gemütlich weiter deinen festen Zins zahlen). Nachteil: Sinkt das Zinsniveau, profitierst du nicht davon – du bleibst auf deinem höheren Zins sitzen. Ausserdem bist du unflexibel: Kommst du vor Ablauf aus irgendeinem Grund aus dem Vertrag raus (z. B. Verkauf der Liegenschaft), können hohe Ausstiegskosten anfallen, weil die Bank den Zinsverlust verrechnet. Eine 10-jährige Festhypothek ist eben fast wie eine Ehe mit der Bank – drum prüfe, wer sich (so lange) bindet! 😉
- Variable Hypothek (SARON-Hypothek): „Variabel“ bedeutet hierzulande heute meistens SARON-basiert. Klassische variable Hypotheken (mit Zinssatz nach Gutdünken der Bank) sind selten geworden; stattdessen orientieren sich variable Modelle am SARON-Zinssatz. Die SARON-Hypothek ist quasi die moderne Geldmarkthypothek: Sie hat keinen festen Endtermin und der Zinssatz passt sich periodisch dem Markt an – oft vierteljährlich. Dein Zins ist dabei SARON + Marge. Steigt der SARON, geht’s rauf mit deinem Hypozins; fällt er, wirst du entlastet. Der grosse Vorteil solcher SARON-Hypotheken: Sie starten meist mit deutlich tieferen Zinsen als lange Festhypotheken. Kurzfristige Zinsen sind normalerweise niedriger als langfristige, deshalb waren Geldmarkthypotheken in den letzten Jahren fast immer die günstigste Finanzierungsform. Historisch gesehen konntest du mit einer SARON-Hypothek oft viel sparen, verglichen mit einer 10-Jahres-Festhypothek. Zudem bist du flexibler: Du kannst in der Regel jederzeit per Quartalsende aussteigen oder in eine Festhypothek wechseln, ohne hohe Strafkosten.
Natürlich gibt’s auch Nachteile: Ungewissheit. Keiner weiss, wo die Zinsen nächstes Jahr stehen. Eine variable Hypothek kann dir also innert kurzer Zeit teurer werden, wenn der SARON (und damit der SNB-Leitzins) steigt. Im Extremfall musst du deutlich mehr Zinsen berappen – darauf musst du vorbereitet sein. Mit ein paar Tricks kann man das Risiko managen (z. B. die gesparte Zinsdifferenz als Reserve auf die Seite legen oder rechtzeitig in Festhypothek wechseln), aber ein Restrisiko bleibt.
Welche ist nun besser? Das hängt von dir ab: Sicherheit vs. Flexibilität. Bist du eher sicherheitsliebend und willst fixe Kosten für die nächsten 10 Jahre? Dann fühlst du dich mit einer Festhypothek wohl. Glaubst du, dass die Zinsen eher fallen oder gleich bleiben, und du möchtest vom aktuell tiefen Niveau profitieren? Dann kann eine SARON-Hypothek attraktiv sein. Viele entscheiden sich auch für eine Mischstrategie: zum Beispiel einen Teil der Summe als Festhypothek und einen Teil variabel, um beide Vorteile zu kombinieren. Wichtig ist, dass du dich mit dem Modell wohlfühlst – schliesslich reden wir hier von Beträgen, bei denen man nicht jede Nacht ins Kissen weinen möchte.
Was ist der SARON-Zinssatz?
SARON steht für Swiss Average Rate Overnight – das ist der durchschnittliche Zinssatz, zu dem sich Schweizer Banken untereinander Geld leihen, über Nacht. Er wird von der Börsenbetreiberin SIX täglich auf Basis realer Transaktionen berechnet. Man kann sich SARON als Nachfolger des früheren LIBOR vorstellen. Damit du es nicht zu kompliziert hast, rechnen die Banken für Hypotheken aber nicht mit dem täglich schwankenden Wert direkt, sondern mit einem Compounded SARON über eine Periode (z. B. über drei Monate gemittelt). Dieser gleitende Durchschnittszins wird dann meist alle drei Monate neu in Rechnung gestellt. Deine SARON-Hypothek wird also beispielsweise quartalsweise dem aktuellen Zinsniveau angepasst.
Ein wichtiger Punkt: Die Schweizerische Nationalbank (SNB) steuert mit ihrem Leitzins indirekt den SARON. Die SNB setzt den Leitzins (aktuell 0,25% per März 2025), und der SARON bewegt sich in einem engen Band darum herum. Das heisst, wenn die SNB den Leitzins erhöht, schiesst auch der SARON nach oben – und umgekehrt. Anfang 2025 lag der SARON irgendwo um 0,2%, Anfang 2024 war er wegen Zinserhöhungen zeitweise über 1,5%. Man sieht: Volatilität gehört dazu. Wichtig für Hypothekarschuldner: Der SARON kann nicht negativ werden in der Berechnung deiner Zinsen – die Banken haben eine Null-Untergrenze eingebaut. Sollte der SARON unter 0 fallen (hatten wir ja schon mal in der Schweiz), zahlst du mindestens die Marge, aber bekommst nichts heraus.
Hier findest du noch weitere Infos zur Saron Hypothek.
Rolle des Referenzzinssatzes
Vielleicht hast du schon vom hypothekarischen Referenzzinssatz gelesen. Das ist eine Kennzahl, die vor allem für Mietwohnungen relevant ist. Der Referenzzinssatz basiert auf dem durchschnittlichen Hypothekarzins der Schweizer Banken und wird vom Bund quartalsweise publiziert, auf ein Viertelprozent gerundet. Warum das wichtig ist? Weil er als Basis für Mietzinsanpassungen dient. Sinkt der Referenzzins, können Mieter eine Mietreduktion verlangen; steigt er, dürfen Vermieter theoretisch mehr verlangen.
Für Eigenheimbesitzer ist dieser Satz eher indirekt interessant. Er zeigt nämlich an, wohin die Reise bei den Hypozinsen im Durchschnitt geht. Anfang März 2025 wurde der Referenzzinssatz von 1,75% auf 1,50% gesenkt – der erste Rückgang seit Jahren. Das signalisiert, dass die durchschnittlichen Hypothekarzinsen im Jahr 2024 gesunken waren (tatsächlich hatte die SNB ja ihren Leitzins im Verlauf von 2024 um 1,25 Prozentpunkte gesenkt). Als Hauskäufer oder Hypothekarschuldner musst du den Referenzzins nicht aktiv in deinen Vertrag einbeziehen, aber es schadet nie, ihn zu kennen: Er ist sozusagen das Thermometer für das Zinsklima auf dem Schweizer Hypothekarmarkt.
Nebenbei zeigt die Statistik auch, wie die Schweizer finanziert sind: SARON-Hypotheken machen etwa nur 20–25% aller Hypotheken aus, der Rest sind grösstenteils Festhypotheken. Die meisten Schweizer setzen also (noch) auf fixe Zinsen. Allerdings waren die letzten Jahre speziell: Viele haben in der Negativzinsphase super günstige 10-jährige Festhypotheken abgeschlossen (teilweise unter 1%). Wenn diese auslaufen, stehen Anschlussentscheidungen an – da lohnt sich ein Vergleich der Hypothekarzinsen besonders.
Wie funktioniert ein Hypothekenrechner?
Online finden sich diverse Hypothekenrechner, mit denen du deine Finanzierung durchspielen kannst. Solche Tools sind praktisch, um ein Gefühl für die Kosten zu bekommen – und um herauszufinden, was du dir leisten kannst. Grundsätzlich fragen die Rechner ein paar Eckdaten ab, zum Beispiel:
- Kaufpreis der Immobilie und Eigenkapital: Daraus ergibt sich die Belehnung (wie viel Prozent des Kaufpreises du als Hypothek brauchst).
- Hypothekarzins (bzw. Annahme davon): Hier kannst du verschiedene Zinssätze ausprobieren – z. B. aktuellen Zins oder einen möglichen Zukünftigen.
- Amortisation: Falls ein Teil der Hypothek zurückgezahlt werden muss (typisch in der Schweiz: die 2. Hypothek muss man innerhalb von 15 Jahren abtragen), berücksichtigt der Rechner die jährliche Rückzahlung.
- Nebenkosten/Unterhalt: Viele Rechner rechnen pauschal mit ~1% des Kaufpreises pro Jahr für Nebenkosten (Heizung, Unterhalt, Versicherungen etc.), oder etwas weniger. Gängig ist z. B. 0,75% vom Immobilienwert pro Jahr als Faustregel.
Anhand dieser Daten spuckt der Hypothekenrechner zwei wichtige Werte aus: Monatliche Gesamtkosten und Tragbarkeit. Die monatlichen Kosten setzen sich aus den Zinsen, der Amortisation (falls vorgesehen) und den Unterhaltskosten zusammen. Die Tragbarkeit zeigt dir, ob diese Kosten im Rahmen deines Einkommens liegen. In der Schweiz gilt üblicherweise: Die Wohnkosten sollten nicht mehr als ein Drittel deines Brutto- (bzw. rund 35% deines Netto-)Einkommens betragen. Und Achtung: Bei der Tragbarkeit rechnen Banken nicht mit dem aktuellen Zins (der vielleicht nur 1% beträgt), sondern mit einem Sicherheitszinssatz von etwa 5%. Warum? Damit du die Hypothek auch dann noch stemmen könntest, wenn die Zinsen kräftig steigen. Der Rechner hilft dir also abzuschätzen, ob die Finanzierung langfristig sicher tragbar ist.
Kurz gesagt: Ein Hypothekenrechner ist wie eine Spielwiese für Zahlenfreunde. Du kannst verschiedene Szenarien testen – Was, wenn der Zins auf 2% steigt? Was, wenn ich 100’000 Franken mehr Eigenkapital einsetze? – ohne gleich bei jeder Bank einen Termin zu brauchen. Natürlich ersetzt so ein Tool keine Beratung, aber es gibt dir ein gutes Gefühl für die Dimensionen. Probier’s mal aus, es ist erstaunlich aufklärend (und irgendwie befriedigend, mit den Zahlen zu jonglieren, findest du nicht?).
Tipps zum Hypothekarzinsen-Vergleich

Einen Hypothekarzinsen-Vergleich solltest du immer anstellen, bevor du dich für eine Finanzierung entscheidest. Die Unterschiede zwischen Anbietern und Modellen können enorm sein. Hier ein paar Tipps, wie du das Beste für dich herausholst:
- Offerten einholen und vergleichen: Klingt banal, wird aber oft ignoriert. Vergleiche mehrere Angebote – mindestens 2–3 verschiedene Offerten sollten es sein. Und zwar nicht nur von deiner Hausbank, sondern ruhig auch von Versicherungen (z. B. Baloise) oder unabhängigen Plattformen. Jede Bank kocht ihr eigenes Süppchen; die Zinssätze können sich locker um 0,2–0,5% unterscheiden. Bei grossen Darlehen bedeutet das tausende Franken pro Jahr!
- Apfel mit Apfel vergleichen: Achte darauf, vergleichbare Konditionen gegenüberzustellen. Beispiel: Zwei 10-jährige Festhypotheken zu vergleichen macht Sinn – aber eine 5-jährige mit einer 10-jährigen zu vergleichen eher weniger. Schau auch aufs Startdatum: Manche Angebote gelten ab sofort, andere erst in einigen Monaten (Forward-Hypothek). Immer schön die gleichen Parameter nehmen, damit du fair bewertest.
- Nicht nur auf den Zins schauen: Der Zinssatz ist wichtig, klar – aber achte auch auf das Kleingedruckte. Gibt es Gebühren für den Abschluss? Wie sind die Kündigungsfristen oder die Bedingungen, um in ein anderes Modell zu wechseln? Insbesondere bei SARON-Hypotheken lohnt es sich, die Details zu checken (Stichwort Zinsanpassungstermine, Zinsusanz etc.). Und bei Festhypotheken: Was passiert, wenn du vorzeitig raus willst? Manche Verträge lassen mit sich reden, andere nicht – das kann im Fall der Fälle sehr teuer werden.
- Verhandeln schadet nie: Hypothekarzins ist kein starrer Preis. Viele Anbieter haben Spielraum nach unten, wenn du verhandelst. Hast du ein besseres Angebot von woanders? Leg es auf den Tisch. Zeig dich als informierter Kunde. Gerade wenn du ein guter, solventer Kunde bist, wollen dich Banken gerne halten – da geht oft noch ein kleiner Zinsrabatt. Frech sein lohnt sich, du kannst höchstens ein „Nein“ kassieren.
- Laufzeiten staffeln: Überleg dir eine Strategie für die Laufzeit. Musst du wirklich die ganze Summe 10 Jahre fest anlegen? Man kann Hypotheken aufteilen, z. B. die Hälfte 5 Jahre fest, die Hälfte 10 Jahre fest, oder ein Teil variabel. So verteilst du das Zinsrisiko. Das ist kein Muss, aber ein Tipp, wenn du dich nicht für eine Laufzeit entscheiden kannst. Allerdings: Nicht in zu viele Tranchen zerstückeln – sonst verlierst du den Überblick und beim Refinanzieren wird’s kompliziert.
- Timing beobachten: Den Zinsmarkt zu timen, ist schwierig – eine Glaskugel hat leider keiner. Trotzdem schadet es nicht, ein Auge auf die Zinsentwicklung zu haben. Lies Nachrichten zur SNB-Politik: Wenn absehbar ist, dass die Zinsen steigen, könnte es sich lohnen, früher abzuschliessen und vielleicht länger zu binden. Wenn hingegen alle von sinkenden Zinsen ausgehen, lohnt es sich eventuell, nicht die längste Laufzeit zu wählen. Aber Vorsicht mit Prognosen: Die haben schon oft falsch gelegen.
- Eigenmittel und Belehnung optimieren: Ein oft übersehener Punkt: Je mehr Eigenkapital du einbringst, desto kleiner die Hypothek und desto bessere Zinskonditionen bekommst du manchmal. Prüfe, ob du vielleicht dein Eigenkapital etwas erhöhen kannst (BVG-Vorbezug? Erbvorbezug? Etc.), um unter gewisse Belehnungsgrenzen zu kommen. Einige Anbieter gewähren ab < 67% Belehnung oder < 80% Belehnung unterschiedliche Konditionen. Aber nicht dein ganzes Polster opfern – Reserve ist wichtig.
Diese Tipps helfen dir, in dem Dschungel der Hypothekarangebote den Durchblick zu behalten. Im Zweifel gilt immer: Fragen, vergleichen, und nicht drängen lassen. Es ist dein Geld und dein Zuhause – also nimm dir die Zeit, den für dich besten Deal zu finden.
Häufige Fehler beim Hypothekenvergleich vermeiden
Wo Menschen entscheiden, passieren Fehler. Damit du nicht in die typischen Fallen tappst, hier die häufigsten Fehler beim Hypothekenabschluss – und wie du sie vermeidest:
- Erstes Angebot blind akzeptieren: Der grösste Fehler ist, einfach das erstbeste Angebot (oft von der Hausbank) zu nehmen, ohne Alternativen anzuschauen. Loyalität zur Bank in Ehren, aber sie kostet dich möglicherweise Tausende von Franken. Vergleiche immer mehrere Angebote, auch wenn’s Überwindung kostet.
- Nur auf den Zinssatz starren: Klar, ein tiefer Zins ist verlockend. Aber Achtung: Ein super tiefer Zins kann mit Haken kommen. Vielleicht ist das Angebot nur in Kombination mit anderen Produkten gültig (Versicherungspaket, Gebühren, Kontozwang). Oder die Konditionen sind unflexibel. Schau also nicht nur auf die Zahl vor dem „%“, sondern auf das Gesamtpaket.
- Laufzeit falsch wählen: Beispiel: Du planst, in 3–4 Jahren umzuziehen, schliesst aber eine 10-jährige Festhypothek ab. Uff – das kann teuer enden. Wähle die Zinsbindung passend zu deinen Plänen. Wenn Unsicherheit besteht, lieber kürzer fest binden oder variabel bleiben. Nichts ist ärgerlicher, als für Jahre an einen Zins gebunden zu sein, der gar nicht mehr zu deinem Leben passt.
- Risiken der SARON-Hypothek unterschätzen: Eine SARON-Hypothek kann verlockend sein, weil der Zins aktuell tief ist. Aber wenn du keine Reserven hast oder bei steigenden Zinsen finanziell an die Decke stösst, ist das riskant. Viele glauben, sie könnten den Anstieg schon rechtzeitig kommen sehen – leider nein, die Märkte überraschen gern. Plan B haben: Könntest du den Zinsanstieg zahlen? Könntest du in eine Festhypothek wechseln? Sei ehrlich zu dir selbst.
- Das Kleingedruckte ignorieren: Hypothek ist nicht sexy, Verträge lesen noch weniger. 😉 Trotzdem: Nimm dir die Zeit, Vertragsbedingungen und Allgemeine Geschäftsbedingungen zu lesen. Dinge wie Kündigungsfristen, Zinsanpassungsmodalitäten (bei SARON), Verlängerungsoptionen, Amortisationspflichten etc. müssen klar sein. Sonst gibt’s evtl. ein böses Erwachen. Falls du was nicht verstehst: fragen, fragen, fragen – dafür sind Berater da (oder unabhängige Experten, siehe unten).
- Tragbarkeit bis zum Anschlag ausreizen: Die Bank sagt, 33% deines Einkommens dürften maximal für Wohnen draufgehen – und du nutzt 33,0%. Klingt effizient, ist aber gefährlich. Lass dir Luft nach oben. Wenn heute alles knapp aufgeht, hast du keine Puffer für Unerwartetes (Zinsanstieg, Jobverlust, Scheidung, etc). Eine finanzielle Reserve oder ein kleiner Puffer bei der Tragbarkeit lässt dich ruhiger schlafen.
Vermeidest du diese Patzer, hast du schon viel richtig gemacht. Und denke daran: Fehler Nummer 0 wäre, sich gar nicht beraten zu lassen. Damit sind wir beim letzten Punkt:
Warum eine unabhängige Finanzberatung sinnvoll ist
Jetzt mal Hand aufs Herz: Hypotheken vergleichen kann zeitaufwändig und komplex sein. Die Angebote ändern, die Fachbegriffe schwirren um die Ohren und jeder Anbieter behauptet natürlich, sein Produkt sei das Nonplusultra. Hier kommt eine unabhängige Finanzberatung ins Spiel. Warum kann das für dich Gold wert sein?
- Expertenwissen: Unabhängige Berater beschäftigen sich täglich mit Hypotheken, Zinsen und allen Finessen. Sie kennen die Marktangebote, wissen um aktuelle Aktionen (vielleicht bietet Bank X gerade Spezialkonditionen an, von denen du nie erfahren würdest) und bleiben am Ball bei Zinsprognosen. Dieses Fachwissen bekommst du auf dem Silbertablett serviert – du musst nicht selbst zum Hypothekarguru werden.
- Objektiver Vergleich: Anders als eine Bank, die nur ihre eigenen Hypotheken verkaufen will, schaut ein unabhängiger Berater neutral auf alle Anbieter. Er vergleicht für dich Offerten von Banken, Versicherungen, Pensionskassen etc. und filtert die heraus, die wirklich zu deinen Bedürfnissen passen. Du kriegst quasi einen maßgeschneiderten Vergleich, ohne dass du dich durch zig Webseiten wühlen musst.
- Zeit und Nerven sparen: Stell dir vor, du müsstest bei 5 Banken Termine machen, deine Situation immer wieder erklären, Offerten einholen, nachverhandeln… Ächz. Ein Finanzberater nimmt dir viel von dieser Arbeit ab. Natürlich solltest du am Ende verstehen, was Sache ist – aber die Vorselektion und das Feilschen darf gern der Profi übernehmen, wenn dir das lieber ist.
- Ganzheitliche Sicht: Eine gute Finanzberatung schaut nicht nur auf den Zinssatz, sondern auf dein ganzes finanzielles Bild. Passt die Hypothek zu deiner Lebensplanung? Macht vielleicht eine indirekte Amortisation via Säule 3a mehr Sinn für dich (Stichwort Steuervorteile)? Wie hoch sollte die Absicherung (Versicherung) sein, damit deine Liebsten im Notfall das Haus behalten können? Solche Fragen gehen über den reinen Zinsvergleich hinaus – und ein unabhängiger Berater stellt sie sicher. Weitere Berechnungen: Miete oder Kauf – was macht mehr Sinn? Amortisation – direkt oder indirekt, welche Option ist günstiger? Dazu Liquiditätsplanung bei Renovierungen in Etappen und Steuerberechnungen, richtiger Versicherungsschutz.
- Unterstützung bei Verhandlungen: Oft können Beratungsfirmen dank ihres Netzwerks sogar bessere Konditionen aushandeln, als du selbst es könntest. Oder sie wissen, wo noch ein Rabatt drinliegt. Sie stehen auf deiner Seite, nicht auf der der Bank. Das kann gerade bei grossen Summen viel ausmachen.
Eine unabhängiger Finanzberater hilft dir, Fehler zu vermeiden, Geld zu sparen und mit einem richtig guten Gefühl in deine Immobilienfinanzierung zu starten. Und ja, am Ende entscheidest du – aber du hast dann alle Fakten auf dem Tisch und jemanden, der sie mit dir übersetzt und einordnet.
Hypothekarzinsen mögen komplex erscheinen, doch mit etwas Wissen und Unterstützung findest du dich im Zins-Dschungel zurecht. Ob SARON-Hypothek oder Festhypothek, ob du selber vergleichst oder dir helfen lässt – wichtig ist, dass du verstehst, was dein Geld kostet und warum. Bleib neugierig, stell Fragen und lass dich nicht von Fachjargon erschlagen. Dann klappt’s auch mit der Traumhypothek – zu Top-Konditionen.
Jetzt bist du dran: Vergleichen, rechnen, überlegen – Ich helfe dir gern, wenn du Klarheit im Hypothekenchaos willst. Viel Erfolg beim Hypothekarzinsen vergleichen! 🏠💰